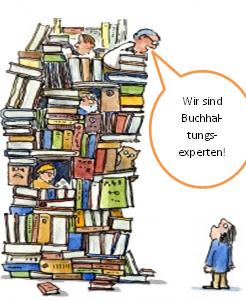Grundzüge der Buchhaltung - Teil 2
Trainer: Gisela Stanjek
In Unternehmungen und anderen Organisationen wie gemeinnützigen Hilfswerken oder öffentlichen Versorgungsbetrieben nimmt das Rechnungswesen eine zentrale Stellung ein. Es dient der quantitativen Erfassung, Darstellung, Auswertung und Planung des betrieblichen Umsatzprozesses. Das Rechnungswesen liefert insbesondere Informationen über die Erreichung der wichtigsten Erfolgs- und Finanzziele.
Im ersten Teil des Online-Kurses "Grundzüge der Buchhaltung" haben Sie das Grundprinzip des Buchungsverfahrens kennengelernt. Hier im zweiten Teil vertiefen Sie Ihre Kenntnisse durch das Buchen von speziellen Geschäftsvorfällen. Diese sind
- Mehrwertsteuer
- Geschäftsfälle der Beschaffungs- und Absatzwirtschaft
- Personalwirtschaft
- Anlagewirtschaft
Sie finden hier eine Inhaltsübersicht und anschließend eine Testseite aus dem Kurs. Viel Spaß!
Inhaltsverzeichnis
- Startseite
- Kapitel Ausgewählte Buchungsvorgänge
- 1: Bankbuchungen
- 2: Übungen
- Kapitel Umsatzbuchungen
- 3: Grundmodell des Warenhandels
- 4: Bestandsveränderungen
- 5: Übungen
- Kapitel Aufgaben, Vorschriften, Grundsätze und Begriffe der Buchführung
- 6: Aufgaben der Buchführung
- 7: Vorschriften und Regeln der Buchführung
- 8: Begriffe der Buchführung/des Rechnungswesens
- 9: Übungen
- Kapitel Kontenrahmen
- 10: Inhalt
- 11: Übungen
- Kapitel Belegorganisation
- 12: Belegarten und ihre Behandlung
- 13: Aufbewahrungspflichten
- Kapitel Bücher der Finanzbuchhaltung
- 14: Das Grundbuch
- 15: Das Hauptbuch
- 16: Personenkonten oder Kontokorrentkonten
- 17: Die Nebenbücher
- 18: Übungen
- Kapitel Buchungen im Personalbereich
- 19: Grundlagen
- 20: Abzüge berechnen und verbuchen
- 21: Verbuchung von Vorschüssen, Sachbezügen und vermögenswirksamen Leistungen (vwL)
- 22: Übungen
- Kapitel Buchungen im Beschaffungs- und Absatzbereich
- 23: Sofortrabatte und Bezugskosten beim Käufer
- 24: Rückgabe von Leihverpackungen und Rücksendungen als Kunde
- 25: Mängelrügen, Boni und Skonti als Kunde
- 26: Sofortnachlässe, Rücksendungen und nachträgliche Preisnachlässe für Kunden
- 27: Übungen
- Kapitel Anlagenwirtschaft
- 28: Zugang von Anlagevermögen
- 29: Abschreibungen
- 30: Geringwertige Wirtschaftsgüter
- 31: Ausscheiden von Anlagegütern
- Kapitel Abschluss
- 32: Zusammenfassung, Wiederholen und Üben
- Abschluss-Seite
Schnupper-Seite (Seite 3)
In diesem Kapitel erfahren Sie,
-
wie Wareneinkäufe und Warenverkäufe verbucht werden
-
stellen Sie fest, dass die Konten unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse sowie Warenvorräte Bestandskonten sind, auf denen nur die Anfangsbestände und die Endbestände verbucht werden. Die Salden werden über die entsprechenden Aufwandskonten gebucht.
Grundmodell des Warenhandels
Handelsunternehmen kaufen Waren ein und verkaufen sie mit Gewinnaufschlag. Das ist erforderlich, um die Kosten zu decken und eine notwendige Verzinsung des Eigenkapitals (=Gewinn) zu erzielen. Ansonsten würden Sie wohl kaum ein Unternehmen gründen wollen, oder?
Industrieunternehmen kaufen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe oder Fertigteile. Sie produzieren daraus unfertige und fertige Erzeugnisse. Umsatzgewinne haben Sie direkt über das Ertragskonto Umsatzerlöse ausgewiesen. Materialverbräuche haben Sie bereits auf das Konto 'Aufwand Rohstoffe' oder 'Aufwand Waren' usw. erfasst. Wir wollen dieses Verfahren verfeinern. Die Varianten zu diesem Thema sind vielfältig. Ich möchte mich daher auf das just-in-time-Verfahren beschränken, zumal dieses Verfahren sowohl im Handel als auch in der Industrie angewendet wird.
Zunächst jedoch ein kleiner Exkurs:
Unser Lieferant erstellt über die gelieferten Waren eine Rechnung. Was muss alles auf einer Rechnung stehen?
Eine Antwort darauf gibt diese Auflistung:
- Name und vollständige Anschrift des Rechnungsempfängers,
- Ihre vom Finanzamt erteilte Steuernummer (USt-Nr.) oder Ihre vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.),
- Ausstellungsdatum der Rechnung,
- fortlaufende Rechnungsnummer,
- Menge und Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder Art und Umfang der sonstigen Leistung,
- Zeitpunkt der Lieferung beziehungsweise Leistung,
- Netto-Entgelt und gegebenenfalls die im Voraus vereinbarte Entgeltminderung (Nachlass, Skonto),
- anzuwendender Umsatzsteuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag,
- bei Steuerbefreiung: einen Hinweis auf die Steuerbefreiung.
Wareneinkaufskonto (WEK) und Warenverkaufskonto (WVK)
Bei der Ableitung der Bestandskonten aus der Aktivseite der Bilanz steht unter der Position „Vorräte" das Konto „Bestand Waren". Auf diesem Konto ist zunächst der Warenbestand zu Beginn des Abrechnungszeitraums (z. B. 01.01.2020) als Anfangsbestand im Soll vorzutragen. Werden nun Waren eingekauft, dann müssten diese auf dem Konto „Bestand Waren“ als Zugang im Soll erfasst werden (Bestandserhöhung). Wenn diese Waren danach verkauft werden, der Bestand also wieder vermindert wird, müsste der Abgang auf dem Konto „Bestand Waren“ im Haben erfasst werden (Bestandsminderung). Damit würde jedoch der Erfolg des Unternehmens nicht dokumentiert werden.
Deshalb werden die Wareneinkäufe als Aufwandskonto und die Warenverkäufe als Ertragskonto geführt. Wenn Sie das GuV-Gliederungsschema gemäß § 275 Abs. 2 HGB betrachten, erkennen Sie als erste Ertragskomponente die Position „Umsatzerlöse“.
Es gibt zwei verschiedene Methoden, die Umsätze sowie den damit verbundenen Einsatz von Waren oder eigenen Erzeugnissen zu verbuchen: Bei der Bruttomethode wird der Umsatzerlös in voller Höhe als Ertrag verbucht, der dazu nötige Waren- oder Erzeugniseinsatz in voller Höhe als Aufwand. In der Buchhaltungspraxis werden die beiden Konten häufig als Warenverkaufskonto (Erfassung der Erlöse) und Wareneinkaufskonto (Erfassung des Wareneinsatzes) bezeichnet. Bei der Nettomethode hingegen wird dem Umsatzerlös zunächst direkt der Waren- oder Erzeugniseinsatz gegenübergestellt, und nur die Differenz wird als Verkaufsgewinn oder -verlust erfolgswirksam im GuV-Konto verbucht.
Beispiel: Die H & S OHG hat Waschmaschinen und Wäschetrockener gegen bar eingekauft in Höhe von 8.200 € und verkaufte ebenfalls bar Waren in Höhe von 15.000 €:
Bruttomethode
(1) Wareneinkaufskonto WEK (=Aufwand Waren) 8.200 € an Kasse 8.200 €
(2) Kasse 15.000 € an Warenverkaufskonto WVK (=Umsatzerlöse Waren) 15.000 €
(3) GuV 8.200 € an Wareneinkaufskonto WEK 8.200 €
(4) Warenverkaufskonto WVK 15.000 € an GuV 15.000€
Nettomethode
(1) WEK (=Aufwand Waren) 8.200 € an Kasse 8.200 €
(2) Kasse 15.000 € an WVK (=Umsatzerlöse Waren) 15.000 €
(3) WVK 8.200 € an WEK 8.200 €
(4) WVK 6.800 € an GuV 6.800 €
Im Rahmen dieser Ausbildung gehen Sie bitte stets vom Bruttoverfahren aus. Dieses Beispiel soll Ihnen auch zeigen, dass es in der buchhalterischen Praxis durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen gibt.
Sie stellen fest: Beide Verfahren führen zum gleichen Ergebnis. Dies wussten Sie sicherlich bereits im Voraus, da beim Nettoverfahren lediglich eine zusätzliche Buchung vorgenommen wurde, nämlich der Abschluss des Wareneinkaufskonto über das Warenverkaufskonto. Dies hat zur Folge, dass auf dem GuV-Konto im Gegensatz zum Bruttoverfahren nur ein (Netto-)Saldo pro Warenkonto ausgewiesen wird.

An dieser Stelle soll es genügen, dass beim Bruttoverfahren die Salden aus dem Wareneinkaufskonto und dem Warenverkaufskonto über das GuV-Konto abgeschlossen werden.
Das Gliederungsschema gemäß § 275 Abs. 2 HGB beruht auf der Bruttomethode. Dementsprechend werden die Verkaufsaktivitäten, die dem primären Geschäftsfeld eines Unternehmens entsprechen, in aller Regel nach der Bruttomethode verbucht.
Auf den Konten Warenvorräte bzw. Warenbestände, Unfertige Erzeugnisse sowie Fertige Erzeugnisse usw. werden lediglich Anfangsbestände, Schlussbestände laut Inventur und als Differenzen Bestandsmehrungen bzw. Bestandsminderungen erfasst. Die Zugänge von Waren, Rohstoffen usw. erfassen Sie auf entsprechenden Einkaufskonten. Es handelt sich dabei um Aufwandskonten. Die Verkäufe (Abgänge) von Waren, Unfertigen Erzeugnissen oder Fertigerzeugnissen werden als Umsatzerlöse erfasst. Es handelt sich dabei um Ertragskonten.
Beispiel: In der Ausgangssituation ist auf dem Konto Rohstoffe im Soll der Anfangsbestand von 26.000 € gegeben. Die Inventur ergibt einen Schlussbestand von 26.000 € im Haben. Es hat sich also bei den Vorräten im Rohstofflager nichts verändert, wir haben keine Bestandsveränderung zu verbuchen.
| Rohstoffe | Soll | Haben |
| Anfangsbestand | 26.000 € | |
| Schlussbestand | 26.000 € | |
| Summe | 26.000 € | 26.000 € |
1. Fall: Auf dem Konto Rohstoffe ist wieder im Soll der Anfangsbestand von 26.000 € gegeben. Die Inventur ergibt diesmal einen Schlussbestand von 30.000 € im Haben. Beim Abschluss des Kontos Rohstoffe errechnet sich also als Saldo auf der Sollseite eine Bestandserhöhung von 4.000 €. Offensichtlich wurden mehr Rohstoffe eingekauft als verbraucht, dadurch kommt es im Lager Rohstoffe zu dieser Bestandserhöhung. Die Gegenbuchung für diese Bestandserhöhung von 4.000 € muss auf dem "Aufwandskonto Rohstoffe" im Haben sein. Durch die Bestandserhöhung reduziert sich der Rohstoffaufwand um 4.000 €. Diese Rohstoffe im Wert von 4.000 € wurden ja nicht verbraucht, sondern auf Lager gelegt. Hier abgebildet ist das Konto Rohstoffe und das Konto Aufwand Rohstoffe.
| Rohstoffe | Soll | Haben |
| Anfangsbestand | 26.000 € | |
| Bestandserhöhung (Aufwand Rohstoffe) | 4000 € | |
| Schlussbestand | 30.000 € | |
| Summe | 30.000 € | 30.000 € |
| Aufwand Rohstoffe | Soll | Haben |
| Zugänge | 20.000 € | |
| Rohstoffe | 4.000 € | |
| GuV | 16.000 € | |
| Summe | 20.000 € | 20.000 € |
2. Fall: Auf dem Konto Rohstoffe ist wieder im Soll der Anfangsbestand von 26.000 € gegeben. Die Inventur ergibt diesmal einen Schlussbestand von nur 24.000 € im Haben. Beim Abschluss des Kontos Rohstoffe errechnet sich also als Saldo auf der Habenseite eine Bestandsminderung von 2.000 €. Offensichtlich wurden weniger Rohstoffe eingekauft als in der Produktion gebraucht wurden, deshalb wurden aus dem Lager Rohstoffe herausgenommen und es kommt zu dieser Bestandsminderung. Die Gegenbuchung für diese Bestandsminderung von 2.000 € muss auf dem "Aufwandskonto Rohstoffe" im Soll sein. Durch die Bestandsminderung erhöht sich der Rohstoffaufwand um 2.000 €. Diese Rohstoffe im Wert von 2.000 € wurden nicht eingekauft und verbraucht, sondern aus dem Lager genommen und verbraucht. Hier abgebildet ist das Konto Rohstoffe und das Konto Aufwand Rohstoffe.
| Rohstoffe | Soll | Haben |
| Anfangsbestand | 26.000 € | |
| Bestandsminderung (Aufwand Rohstoffe) | 2.000 € | |
| Schlussbestand | 24.000 € | |
| Summe | 26.000 € | 26.000 € |
| Aufwand Rohstoffe | Soll | Haben |
| Zugänge | 20.000 € | |
| Rohstoffe | 2.000 € | |
| GuV | 22.000 € | |
| Summe | 22.000 € | 22.000 € |
 Probieren Sie es gleich mal aus:
Probieren Sie es gleich mal aus:

I. Formulieren Sie die Buchungssätze zu diesen Geschäftsfällen eines Möbelherstellers:
Anfangsbestände:
Rohstoffe 36.000 €
Hilfsstoffe 8.000 €
Betriebsstoffe 12.000 €
Forderungen aLL 0 €
Bank 10.000 €
Verbindlichkeiten 40.000 €
Eigenkapital ?
Erfolgskonten: Aufwand Waren (=Wareneinkaufskonto), Aufwand Rohstoffe, Aufwand Hilfsstoffe, Aufwand Betriebsstoffe, Fremdinstandhaltung, Umsatzerlöse für Waren (=Warenverkaufskonto)
1. Verkauf von Schreibtischen gegen Banküberweisung, netto 12.000 € + 19 % USt.
2. Kauf von Rohstoffen 10.000 €, Betriebsstoffen 4.000 € und Hilfsstoffen 2.000 € gegen Rechnung, jeweils netto + 19 % USt.
3. Verkauf von Büroschränken laut Ausgangsrechnung 56.000 € (brutto).
4. Reparatur eines Fahrzeuges laut Eingangsrechnung 452 € netto + 19 % USt.
Endbestände:
Rohstoffe 33.000 €
Hilfsstoffe 9.000 €
Betriebsstoffe 10.000 €
II. Nutzen Sie das Buchhaltungsblatt02.xlsx. Erstellen Sie eine Eröffnungsbilanz. Formulieren Sie die Buchungssätze und verbuchen Sie die Geschäftsfälle. Ermitteln Sie gegebenenfalls die Bestandsveränderungen. Erstellen Sie ein GuV-Konto. Ermitteln Sie den Erfolg.
Hinweis: Ändern Sie die Endbestände (Saldo) in den Bestandskonten entsprechend den Vorgaben ab. Verbuchen Sie die Bestandsdifferenzen für Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffe auf den entsprechenden Aufwandskonten. Achten Sie dabei darauf, dass die Bedingung 'Soll' an 'Haben' immer erfüllt ist. Erfassen Sie die Buchungssätze!

Senden Sie diese Aufgabe Ihrem Online-Trainer. Danke.